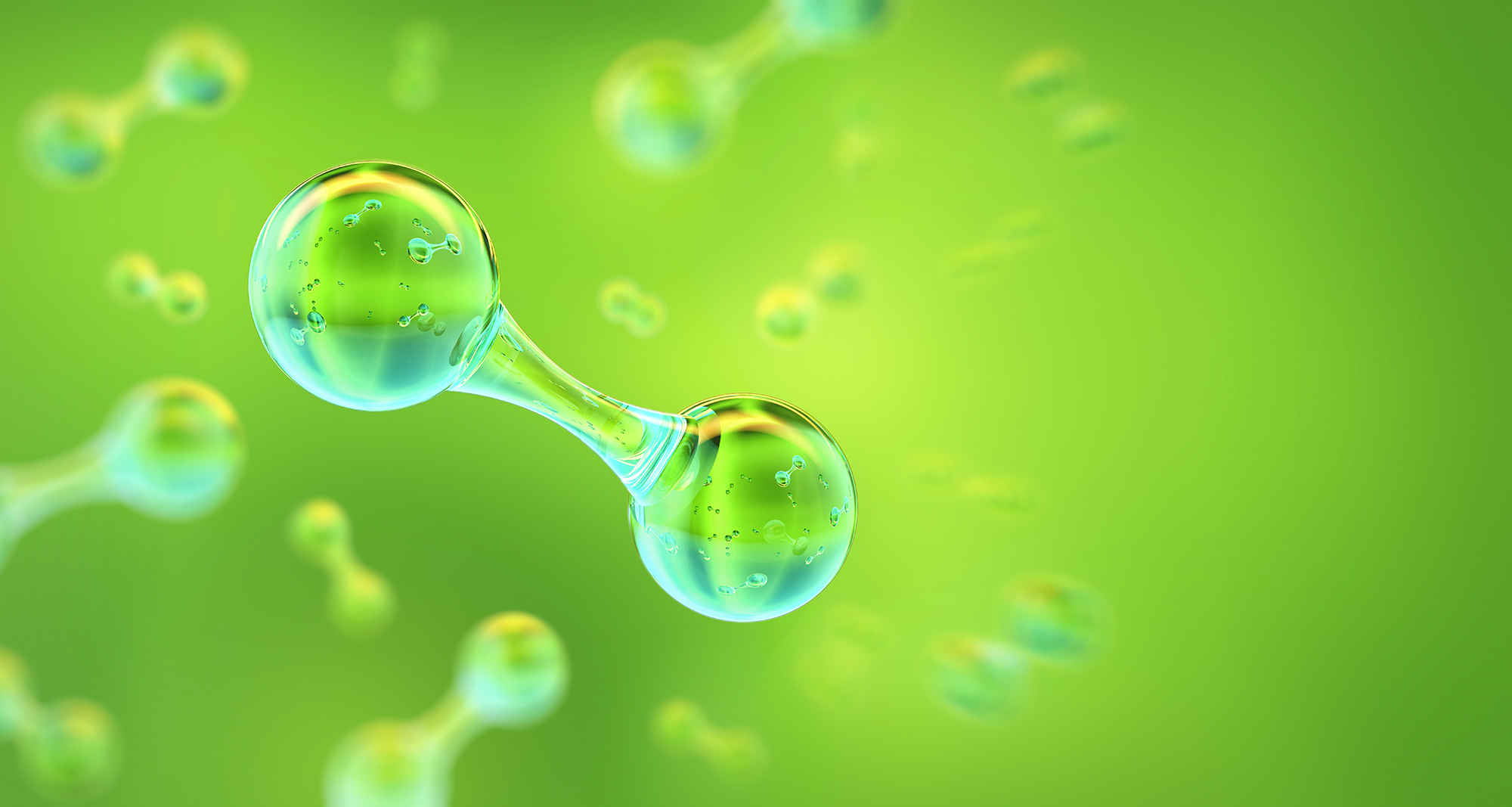Perspektive klimaneutrale Stahlindustrie

Die Stahlindustrie in Deutschland steht in den Startlöchern, um ihren Beitrag für eine klimaneutrale Wirtschaft in Deutschland durch konkrete Projekte zu leisten. Sie ist die Branche, die Vorreiter sein kann, Klimaschutz und internationale Wettbewerbsfähigkeit miteinander zu verbinden. Stahl ist der nachhaltige und essentielle Werkstoff für Energiewende und Transformation. Der Werkstoff lässt sich unbegrenzt recyceln und wiedereinsetzen, was mit der Elektrostahlproduktion in Deutschland erfolgreich geschieht.
Die Transformation der Stahlproduktion ist auch von großer Bedeutung gerade für die exportorientierten Wertschöpfungsketten in Deutschland und sie ist eine vergleichsweise „low-hanging-fruit“: In keiner anderen Branche können vergleichbar große CO2-Mengen so schnell reduziert und große Sprünge in eine klimaneutrale Produktion unternommen werden und damit zugleich auch der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft unterstützt werden. Stahl hat hohe Relevanz für eine klimaneutrale Wirtschaft am Standort Deutschland.

Transformation der Stahlindustrie: Politischer Rahmen entscheidend
Damit die Stahlunternehmen in der Lage sind, ihre ambitionierten Klimaschutzprojekte rasch und wirtschaftlich umzusetzen, benötigen sie einen angemessenen politischen Rahmen. Dazu gehören ebenso energiewirtschaftliche Voraussetzungen, wie der massive Ausbau von Erneuerbaren Energien und der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft mit entsprechender Infrastruktur, wie auch Anschubförderungen und die Absicherung der Mehrkosten für die Erzeugung von grünem Stahl durch sogenannte Klimaschutzverträge (Contracts for Differences). Ein wirksamer Carbon-Leakage-Schutz auf Basis der freien Zuteilung von Zertifikaten im EU-Emissionshandel sichert zudem die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Stahlproduktion. Ein entscheidender Aspekt, der noch weiter an Bedeutung gewonnen hat, da die Wirtschaft derzeit mit immer weiter steigenden Kosten für Strom und Gas konfrontiert ist.
 Dabei muss besonders berücksichtigt werden, dass auch die konventionellen Anlagen in der Übergangsphase weiter wirtschaftlich betrieben werden können. Dies ist auch erforderlich, da die Transformation der Stahlindustrie nicht von heute auf morgen, sondern in Stufen, verläuft. Der derzeit viel diskutierte Ansatz eines CO2-Grenzausgleichs auf Vorschlag der EU-Kommission (Carbon Border Adjustment – CBAM) würde nicht verhindern, dass die Stahlproduktion künftig mit geringeren Klimaschutzauflagen in anderen Teilen der Welt stattfinden würde, wie eine Studie der Prognos AG bestätigt.
Dabei muss besonders berücksichtigt werden, dass auch die konventionellen Anlagen in der Übergangsphase weiter wirtschaftlich betrieben werden können. Dies ist auch erforderlich, da die Transformation der Stahlindustrie nicht von heute auf morgen, sondern in Stufen, verläuft. Der derzeit viel diskutierte Ansatz eines CO2-Grenzausgleichs auf Vorschlag der EU-Kommission (Carbon Border Adjustment – CBAM) würde nicht verhindern, dass die Stahlproduktion künftig mit geringeren Klimaschutzauflagen in anderen Teilen der Welt stattfinden würde, wie eine Studie der Prognos AG bestätigt.
Klimaneutrale industrielle Wertschöpfungsketten müssen sich langfristig selbst tragen. Damit sich nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln können, müssen sogenannte grüne Leitmärkte auf den Weg gebracht werden. Das bedeutet, dass z.B. verbindliche Anreize zum Einsatz klimafreundlicher Vorprodukte gesetzt werden. Je schneller der Hochlauf von z. B. grünem Stahl gelingt, umso eher kann staatliche Förderung perspektivisch abgelöst und das industriepolitische Ziel erreicht werden, grünen Stahl zuerst am Standort Deutschland zu produzieren.
Grüner Wasserstoff: Größte Klimaschutzwirkung in der Stahlindustrie
Für den Weg in eine klimaneutrale Stahlindustrie ist Wasserstoff unverzichtbar. Besonders in der Primärstahlerzeugung lässt sich durch den Einsatz des Energieträgers ein Großteil der CO2-Emissionen einsparen. Dabei hat die Stahlindustrie im Vergleich zu anderen potenziellen Einsatzsektoren die größte Klimaschutz-Wirkung. So lassen sich pro Tonne eingesetztem klimaneutralen Wasserstoff 28 t CO2 einsparen.
*Mittelwert Potenziale heute und 2050
Quelle: Berechnungen der WV Stahl, unter Einholung einer Stellungnahme des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Die Stahlindustrie ist in der Lage, durch Investitionen in neue Produktionsverfahren klimaneutralen Wasserstoff bereits vor 2030 einzusetzen und damit hohe CO2-Einsparungen zu erzielen. Auf diese Weise kann sie einen erheblichen Beitrag zur Erfüllung des Klimaziels für 2030 und zum Aufbau der Wasserstoffwirtschaft leisten. Bei einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 30 Prozent würden pro Jahr 17 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Um den gleichen Klimaschutzeffekt zu erzielen, müssten 8,5 Millionen Pkw (18 Prozent aller Pkw) durch E-Autos ersetzt werden, die ausschließlich mit Grünstrom fahren. Ein um 95 Prozent verminderter CO2-Ausstoß der Stahlindustrie würde zu einer Einsparung von ca. 55 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr führen. Um diese CO2-Minderung zu erreichen, müssten 28 Millionen Pkw (60 Prozent aller Pkw) durch E-Autos ersetzt werden. [1]
Der Weg zur grünen Stahlproduktion in Deutschland
Wenngleich die Stahlindustrie in Deutschland den Werkstoff Stahl heute weltweit zu den besten Bedingungen produziert, ist der Weg zur Klimaneutralität nur mit einem Technologiewechsel insbesondere bei der Primärstahlerzeugung möglich. So konnten die CO2-Emissionen der kohlebasierten Hochofenroute in den vergangenen Jahrzehnenten zwar kontinuierlich auf heute ca. 1,7 Tonnen CO2 pro Tonne Rohstahl gesenkt werden, inzwischen stößt dieser Prozess aber an sein technisches Optimum. Um aus den oxidischen Eisenerzen klimaneutral Roheisen zu erzeugen, kann als Reduktionsmittel jedoch anstelle von Kohlenstoff auch Wasserstoff eingesetzt werden. Dabei entsteht neben reinem Eisen Wasserdampf anstelle von CO2.
Infografik: Wege zum grünen Stahl
Die Direktreduktion mit Wasserstoff und die schrottbasierte Elektrostahlproduktion sind zwei wesentliche Bausteine einer klimaneutralen Stahlindustrie.

Download: Infografik „Wege zum grünen Stahl“ (.pdf)
Direktreduktion: klimaneutral mit Wasserstoff
Mit der wasserstoffbasierten Direktreduktion (kurz DRI: Direct Reduced Iron) steht hierfür eine erprobte und praxistaugliche Technologie zur Verfügung, mit der sich die CO2-Emissionen gegen Null senken lassen. Dabei werden die pellet-förmigen Eisenerze in einem Schachtofen von gasförmigem Wasserstoff umströmt und bei ausreichender Reaktionsenergie reduziert. Da dieser Prozess in der sogenannten DRI-Anlage bei niedrigeren Temperaturen stattfindet als im Hochofen, wird kein flüssiges Roheisen erzeugt, sondern festes Eisen, so genannter Eisenschwamm. Weiterverarbeitet wird dieser beispielsweise in einem Elektrolichtbogen- oder Schmelzofen, wo aus ihm Stahl erschmolzen wird. Wichtig für den Einsatz von Wasserstoff ist, dass bei seiner Herstellung kein oder nur sehr wenig CO2 emittiert wird und er damit nahezu klimaneutral ist.
Auch erdgasbasierte Direktreduktion spart massiv CO2 ein
Solange klimaneutraler Wasserstoff auf absehbare Zeit noch nicht ausreichender Menge zur Verfügung steht, kann zur Substitution auch Erdgas flexibel in der Direktreduktion eingesetzt werden. Da Methan als Hauptbestandteil des Erdgases ein wasserstoffreiches Gas ist, lassen sich dadurch bereits bis zu zwei Drittel der CO2-Emissionen einsparen.
Wasserstoffeinsatz im Hochofen für kurzfristige Emissionsminderungen
Prinzipiell ist der Einsatz von Wasserstoff auch im Hochofen möglich: Durch das Einblasen von Wasserstoff anstelle von pulverisierter Einblaskohle können ein Teil des Reduktionsmittels Kohlenstoff durch Wasserstoff ersetzt und die Emissionen bis zu technisch maximal 20 Prozent reduziert werden. Ein vollständiger Verzicht auf Kohle bzw. Koks ist jedoch nicht möglich, da dieser konventionelle Prozess auf die stützende Wirkung des Koks angewiesen ist. Die übergangsweise Einblasung von Wasserstoff im Hochofen kann den Weg zur klimaneutralen Stahlindustrie daher nur flankieren. Perspektivisch führt an der Ablösung der klassischen Hochofenroute durch die wasserstoffbasierte Direktreduktion kein Weg vorbei.
Elektrostahlproduktion: ressourcenschonend und CO2-arm
Ein zweiter Baustein für eine klimaneutrale Stahlindustrie, mit der Stahl bereits heute relativ CO2-arm erzeugt wird, ist die schrottbasierte Elektrostahlproduktion (auch Sekundärstahlproduktion). Im Elektrolichtbogenofen wird Schrott mit Hilfe von Strom zu neuem Stahl geschmolzen, wobei direkte Emissionen in Höhe von etwa 0,1 bis 0,3 Tonnen CO2 pro Tonne Rohstahl entstehen. Da Stahl ohne Qualitätsverlust immer wieder recycelt werden kann, trägt diese Sekundärstahlproduktion zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Ressourcenschonung gleichermaßen bei. Ein Paradebeispiel für Kreislaufwirtschaft. Insbesondere aufgrund der begrenzten Menge an Stahlschrott und des spezifischen Produktportfolios kann der Anteil der schrottbasieren Stahlproduktion an der Gesamterzeugung von heute etwa 30 Prozent jedoch nicht unbegrenzt gesteigert werden.
Wie bei der Transformation der Primärstahlproduktion wird auch in der Sekundärstahlroute perspektivisch der Einsatz von grünem Wasserstoff unverzichtbar sein, um beispielsweise die Erdgasverwendung in den Brennern an den Elektrolichtbogenöfen durch Wasserstoff zu ersetzen. Zudem wird klimaneutraler Wasserstoff für die Umstellung von Hochtemperaturprozessen in der Weiterverarbeitung benötigt, wo sich Werkstücke aufgrund von Form und Abmessungen nicht elektrisch erwärmen lassen.
Infografik: Kreislaufwirtschaft mit Stahl für eine klimaneutrale Zukunft
Die schrottbasierte Elektrostahlproduktion trägt die Kreislaufwirtschaft und ist neben der wasserstoffbasierten Primärstahlerzeugung wesentlicher Baustein einer klimaneutralen Stahlindustrie. Erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff machen sie CO2-neutral.

Download: Infografik „Kreislaufwirtschaft mit Stahl für eine klimaneutrale Zukunft“ (.pdf)
Grüner Stahl für eine grüne Wirtschaft
Der Umbau Deutschlands zu einem grünen Industriestandort ist eine große Herausforderung. Er ist aber machbar, wenn Politik, Gesellschaft und Wirtschaft an einem Strang ziehen. Brüssel und Berlin müssen jetzt den Rahmen für verbindliche Zusagen schaffen, damit die neuen klimafreundlichen Technologien auf den Weg gebracht werden können. Eine klimaneutrale Stahlindustrie in am Standort Deutschland ist nicht nur gut fürs Klima. Sie verhilft auch auch Kunden zu grünen Produkten und ist somit die Basis für eine klimaneutrale Zukunft.

[1] Quelle: KBA, UBA, E.ON, WV Stahl
Beitragsbild: Felix Mittermeier von Pexels
Meldungen
-
5. Juni 2023 | meldung
Klimaschutzverträge: „Gut, dass Bewegung in die Umsetzung kommt“
Für die Stahlindustrie sind Klimaschutzverträge ein zentraler Baustein in der politischen Rahmensetzung für die Transformation in Richtung Klimaneutralität.

-
14. März 2023 | meldung
Brief an die Politik: 10 politische Maßnahmen zum Green Deal Industrial Plan
Zehn Handlungsfelder, in denen wir konkrete politische Maßnahmen für erforderlich halten, um den Übergang zur Klimaneutralität erfolgreich gestalten zu können.

-
1. Juli 2021 | meldung
10 Maßnahmen für einen starken Stahlstandort Deutschland
Die Stahlindustrie in Deutschland erwartet in zehn zentralen Themenbereichen Maßnahmen, die den Unternehmen eine verlässliche Zukunftsperspektive an den Standorten bieten.

Medieninformationen
-
16. März 2023 | medieninformation
Net Zero Industry Act: Nicht ausreichend für die industrielle Transformation
Die EU-Kommission hat heute ihren Vorschlag eines „Net Zero Industry Act“ vorgestellt. Aus Sicht der Stahlindustrie reicht dieser jedoch nicht aus, um das Ziel grüner industrieller Wertschöpfungsketten zu erreichen. Dazu Dr. Martin Theuringer, Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Stahl: „Der Ansatz der Europäischen Kommission sollte sich nicht nur auf wenige ausgewählte „Net-Zero-Technologien“ beschränken, sondern insbesondere auch Basisindustrien […]

-
14. Dezember 2022 | medieninformation
Laufende Konsultation der Bundesregierung Stahlindustrie: Klimaschutzverträge zügig auf den Weg bringen
Gegenwärtig läuft die Konsultation zu dem lange erwarteten Entwurf zur Förderrichtlinie für die Klimaschutzverträge. Klimaschutzverträge dienen dazu, die Mehrkosten CO2-armer Produktionsverfahren so auszugleichen, dass sich entsprechende Investitionen der Unternehmen rechnen können. Dazu Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl: „Die Klimaschutzverträge sollten möglichst rasch auf den Weg gebracht werden. Sie sind ein zentrales Element, um […]

-
6. April 2022 | medieninformation
Osterpaket: Stahlindustrie begrüßt beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien. Jetzt Klimaschutzverträge auf den Weg bringen
Zur heute vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzesnovelle für die Beschleunigung des Erneuerbaren-Ausbaus (Osterpaket) erklärt Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl: „Grüner Strom und grüner Wasserstoff sind unverzichtbare Voraussetzungen auf dem Weg in eine klimaneutrale Stahlproduktion. Daher ist es zu begrüßen, dass die Bundesregierung nun mit dem Energiesofortmaßnahmenpaket den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien auf den […]

-
14. März 2022 | medieninformation
Studie: Pläne der EU-Kommission zu CO2-Grenzausgleich und Emissionsrechtehandel gefährden klimaneutrale Zukunft der Stahlindustrie
Die Pläne der EU-Kommission zu einem CO2-Grenzausgleich und zum europäischen Emissionsrechtehandel stellen den Erfolg der Transformation der Stahlindustrie hin zur Klimaneutralität massiv in Frage. So lautet ein zentrales Ergebnis der Studie „Transformationspfade der Stahlindustrie in Deutschland“, die von der Prognos AG im Auftrag der Wirtschaftsvereinigung Stahl erstellt wurde. Mit dem Abbau der freien Zuteilung bis […]

-
11. Januar 2022 | medieninformation
Klimaschutzsofortprogramm ist wichtiges Signal für die Transformation der Stahlindustrie in Deutschland
Vor dem Hintergrund, dass milliardenschwere Projekte in der Stahlindustrie entscheidungsreif sind, ist es gut und richtig, dass Bundeswirtschaftsminister Habeck nun aufs Tempo drückt und die entsprechenden politischen Instrumente für die Transformation rasch auf den Weg bringen will.

-
8. Dezember 2021 | medieninformation
Neue Bundesregierung muss jetzt konkreten und verlässlichen Rahmen für Transformation in Richtung Klimaneutralität liefern
Mit der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler und der Vereidigung der Bundesministerinnen und -minister des Kabinetts nimmt die neue Bundesregierung ihre Arbeit auf. Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl erwartet mit Blick auf die Transformation in Richtung Klimaneutralität rasch konkrete, sichtbare Schritte: „Die neue Bundesregierung hat sich einen ambitionierten Klimaschutz als zentrales Ziel […]

-
21. Oktober 2021 | medieninformation
Klimaschutz: BDI-Studie bestätigt wesentliche Rolle der Stahlindustrie für das Erreichen der Klimaziele
Im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) hat die Boston Consulting Group (BCG) im Rahmen der Studie „Klimapfade 2.0“ untersucht, welche Instrumente und Maßnahmen nötig sind, um das nationale Klimaziel 2030 zu erreichen. Dazu Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl: „Die Studie zeigt, dass der Industriestandort Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität mit gewaltigen Herausforderungen konfrontiert ist. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Stahlindustrie mit ihren Projekten eine wesentliche Rolle spielt, um das 2030-Ziel zu erreichen.“

-
27. September 2021 | medieninformation
Bundestagswahl: Herausforderungen der Transformation machen rasche Regierungsbildung erforderlich
Nach Wochen des Wahlkampfs, fordert WV Stahl-Präsident Hans Jürgen Kerkhoff den Fokus jetzt auf eine möglichst rasche Regierungsbildung zu legen.

Blogbeiträge
-
14. April 2022 | blogbeitrag
Interview mit Dr. Michael Böhmer (Prognos AG): „Die Transformation kann mit dem richtigen politischen Rahmen gelingen“
Die Studie „Transformationspfade für die Stahlindustrie in Deutschland“ der Prognos AG zeigt, unter welchen Bedingungen die Transformation der Stahlindustrie hin zur Klimaneutralität gelingen kann. Über die Ergebnisse haben wir mit Dr. Michael Böhmer, Chief Economist Corporate Solutions Prognos AG, gesprochen.